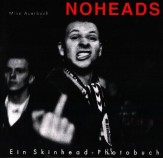Eine Photo- und Textserie über die Skinheads und SKA!
Mit über 70 einmaligen Bildern von SKA to SKA! u.a. Laurel Aitken, Bad Manners ...
and much more ... skinhead stuff ... und photografische Kunst.
"1969 ist das Jahr der Skinheadbewegung. In den Bezirken der englischen Unterklasse ist es nicht so einfach, vor der Realität zu kneifen und sich an etwas anderes hineinzuträumen. Und zwar weil die Realität Geldnot, Arbeitslosigkeit, triste Wohnverhältnisse, Langeweile und vor allem keine berauschende Perspektive bedeutet."
Ich bin schön.
Das wird mir nicht jeder glauben, aber ich weiß es. Ich bin Skinhead. Und das heißt vor allem, ich bin ich. Ich beginne mich unwohl zu fühlen, wenn meine Haare länger als einen Zentimeter werden. Oder wenn der Staub auf meinen Doc's den Glanz erstickt. Vielleicht reicht das in den Augen mancher Leute schon, ein Arschloch zu sein. Aber das ist egal. Ich war auch schon schlimmeres als ein Arschloch. Rassist, Nazi, Totschläger, Kindermörder, Handlanger. Vor allem in der letzten Zeit. Egal. Nicht die Zeit. Die Bezeichnungen. Die einfachste von vielen vorgeschlagenen Lösungen wäre dann, sich äußerlich so zu verändern, dass man nicht mehr mit Skinheads und solchen Bösewichtern verwechselt werden kann. Ansonsten wäre man erwiesenermaßen ein masochistisch veranlagter Schwachkopf oder jemand, der seine Lebensenergie daraus bezieht, sich mit anderen zu streiten und sich eventuell die Köpfe einzuschlagen. Alles falsch. Es steckt etwas dahinter.
Zuerst finden die Leute zu ganz nichtigen Anlässen zueinander. Heutzutage jedenfalls. Ein Konzert zum Beispiel. Ob SKA, Soul, Oi! Punk oder Hardcore. Musik verbindet.
Dann sind es vielleicht die Klamotten, das Outfit. Das Benehmen auch. Laut und lustig. Ohne abgespreizten kleinen Finger. Das wichtigste aber, glaube ich, sind die Erfahrungen. Die schweißen
zusammen. Die guten und die schlechten.
Das ist vor allem die Erfahrung, mit anderen nicht auf der Seite der Gesellschaft aufgewachsen zu sein, auf der die großen Entscheidungen gefällt werden. Entweder man arrangiert sich vollständig oder man sucht sich die Form, in der man seien Widersand leistet. Ob nun gegen bürgerliche Lebensanschauung und ihren Muff oder auch nur gegen spießige Ästhetikvorstellungen.
Ansonsten klingen die guten Erfahrungen eher bedeutungslos. Zu sehen, dass man auf einem Konzert nicht alleine ist. Auf der Straße schmutzige Lieder zu singen und von den Leuten nicht die "Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht" -Gesichter zu sehen, sondern "Von denen ist ja nichts anderes zu erwarten". Oder der Kontakt zu neuen Leuten. Man spricht sich eher an, wenn man nicht erst nach dem Wetterfragen muß, obwohl einem die blöde Sonne auf den Pelz brennt oder man schon nasse Füße hat. Es gibt immer obercoole Ausnahmen. Die Unantastbaren jeder Szene, oder die, die sich dafür halten. Sei's drum. Jedenfalls soll niemand sagen, er käme ohne diese Dinge aus. Es wird viel gepost. Aber Poserei hat wenig, eigentlich gar nichts mit Smartheit oder Lässigkeit zu tun. Eher mit unverarbeiteten Kindheitsproblemen. Sich gemeinsam besser zu fühlen, indem man mehr Spaß hat als andere. Inklusive eines sportlichen Matchs vielleicht. Das ist okay.Die schlechtesten Erfahrungen haben viel mit Kampf zu tun. Obwohl nicht kämpfen an sich schlecht ist. Aber das Ausfechten von Auseinandersetzungen, die aufgezwungen sind, ist es schon. Sei es mit Moralaposteln, die jeden Kurzhaarigen partout erst einmal zum Idioten oder zum Verbrecher erklären. Dem kann man mit Stolz begegnen.
Man weiß halt, dass es halt nicht so ist. Wenn diese Vorurteile darin münden, dass man selber flachgeschlagen auf dem Straßenpflaster liegenzubleiben droht, muss man
notfalls mit der Faust dagegen kämpfen. Wer Skins überhöhte Gewaltbereitschaft vorwirft, sollte sich angucken, wie fies und gewalttätig die Welt um die paar Glatzköpfe herum ist.
"Skinhead" wird in einer Zeit geboren, als sich die Gesellschaft gerade sanft daran zu gewöhnen beginnt, dass beatlige Pilzköpfe noch lange nicht das Non Plus Ultra der
zu tolerierenden Haarlängen zu bedeuten hatte. Frühhippies sind hip und Blumenmuster. Es wir wieder einmal erkannt, dass die Welt eigentlich verdammt schlecht ist und dass eine angenehme Alternative
darin bestände, dieser Welt über einen netten Trip zu entfliehen. 1969 ist das Jahr der Skinheadbewegung. In den Bezirken der englischen Unterklasse ist es nicht so einfach, vor der Realität zu
kneifen und sich in etwas anderes hineinzuträumen. Und zwar weil die Realität Geldnot, Arbeitslosigkeit, triste Wohnverhältnisse, Langeweile und vor allem keine berauschende Perspektive bedeutet.
Skinhead war eine Reaktion auf gesellschaftliche Verhältnisse, nicht eine bockige Gegenbewegung einiger biersaufender proletarischer Rüpel zur dopegeschwängerten Kreation bürgerlicher Aussteigerkids.
Es gab auch keine tragende Ideologie, die im entferntesten einen gesellschaftlichen Gegenentwurf beinhaltet hätte.
Skinheads versuchten in der Regel nicht, ihre Andersartigkeit durch besonders ausgeflipptes, die Konventionen brechendes Outfit auszudrücken. Sie waren im Gegenteil
sogar eher konservativ. Im Denken wie im Einkleiden. Dass kurze Haare praktisch sind, weiß fast jeder. Keine Millionen für Friseure, keine Motten im Pelz, keine herausgerissenen Büschel im Streit.
Was will man mehr. Außerdem sieht es gut aus. Jedenfalls zählten diese Argumente. Hemden mit festgeknöpften Kragenecken, schmale Hosenträger, in der Regel enge Blue Jeans oder Stay-Pressed-Hosen mit
unverwüstlicher Bügelfalte und ständig geputztes Schuhwerk stellten auch einen harten Kontrast zu den Schlabberklamotten des Hippie-Trends dar. Wer würde nicht, wenigstens damals, Mamis Liebling
gewesen sein, wenn er mit nettem Hemd und Pullover oder Westover mit V-Ausschnitt oder gar im 3-Bottom-Suit, dem klassischen 60er Jahre-Anzug, am Wochenende durch die Gegend rannte. Skinheads hatten
ihre Wurzeln in der Realität der Endsechsziger. Auch kulturell. Sie waren das Produkt des Zusammenflusses zweier Subkulturen, die viel an Rebellion und kultureller Vielfalt einbrachten. Teile der
Mods, die auch schon vorher die Straßen unsicher machten. Ob mit ihren Vespas oder, speziell die Brightoner Strandpromenaden, während heftiger Land- und Seeschlachten mit ebenfalls hauptsächlich zu
diesem Zweck angereisten Rockercliquen. Die ursprünglichen Rude Boys, Jugendliche, die slebt oder deren Eltern Einwanderer aus den ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik waren, und ähnlich wie
ihre Leute auf Jamaika Cliquen bildeten. Begrenzt ist diese Strömung mit den heutigen sogenannten multikulturellen Streetgangs vielleicht am ehesten vergleichbar.
Die Eigenheiten dieser beiden Subkulturen schlugen sich dann in vielem auch im Erscheinungsbild und bestimmten Charakteristika der Skinheadszene nieder. Zum Beispiel im
schon erwähnten Outfit, das sehr modegeprägt ist, oder aber in den typischen zentimeter- oder streichholzlangen Haaren. Aber auch in den favorisierten Musikstilen der Kurzhaarigen. Ska, Reggae und
Soul waren die Töne, die Skinheads im allgemeinen auf die Tanzböden riefen.
Es waren Skinheads, die Leute wie Desmond Dekker, der heute zu jedem zweiten 60s-Revival auf die Bühne gekarrt wird, zu Stars machten. Und es waren zum Beispiel Rude
Boys wie Bob Marley, die Musik machten, die von Skinheads heftigst gehört wurden. Jedenfalls bevor Mr. Marley die Religiosität für sich entdeckte. Im übrigen dauerte es auch, bis sich Skinheads als
Bezeichnung für die neue Bewegung durchsetzte. Die Betitelungen unterscheiden sich zum Beispiel auch regional und reichten von Nohead über Bootboys bis Peanuts.
Fußball war eine schon damals sehr beliebte Freizeitbeschäftigung für Skins. Vielleicht nicht immer als aktive Mitspieler, auf jeden Fall aber als Fan der eigenen
Mannschaft. Fußball war laut, dynamisch, manchmal sogar spannend. Mit den Spielern konnte man sich oft noch identifizieren, sofern sie genau so einfache Leute waren wie man selber. Fußball war kein
aristokratischer Sport. Und man konnte Gott und dem Rest der Welt und vor allem dem Mob von der gegnerischen Mannschaft lautstark zeigen, wie wenig man von allem hielt. Provokation gehört einfach
dazu.
Überhaupt hing und hängt Skinheads der Ruf an, dass sie in eine Auseinandersetzung lieber hineinsteuern, als ihr aus dem Wege zu gehen. Das stimmt bis zu einem Punkt, an
dem vergessen wird, dass sie sich wie der große Teil der britischen proletarischen Unterschicht benommen haben. Ganz einfach, weil sie genau aus dieser Schicht kamen. Ähnlich verhält es sich mit dem
gerade heutzutage immer wieder mit Skinheads in ursprüngliche Nähe gebrachten Rassismus. Eine tief im gesellschaftlichen Sein verwurzelte Erscheinung wie Rassismus in deckungsgleichen Zusammenhang
mit einer einzigen Subkultur zu setzen, zeugt von verkürztem Sachverständnis. Nie waren alle Skinheads Rassisten; genauso wenig sie es alle nicht waren. Skinheadbewegung hatte immer mit
schwarz-weißem Durcheinander zu tun. Einen ohne Zweifel bei vielen anzutreffenden ausgeprägten Patriotismus zum unanfechtbaren beweis ihres Rassismus zu stempeln, ist Scheuklappenstrategie und
seinerseits intolerant und ein Vorurteil. Im laufe der 70er Jahre wurde es ruhiger um Skinheads. Was ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit betraf und auch die kulturellen Bewegungen, die in der Szene
vonstatten gingen. Reggae als die klassische Skinheadmusik wurde immer mehr dominiert von der Spielart, die diejenigen Schwarzen zu ihrem Sprachrohr machten, die ihre ethnischen, kulturllen und
religiösen Wurzeln in Afrika wiederentdeckten und in den Mittelpunkt ihrer Songs rückten. Genau, Bob Marley ist mit seinem Rastafarian Reggae eine Koryphähe dieser Entwicklung.
Im Zeitraum zwischen den Endsiebzigern und den ersten Jahren des darauffolgenden Jahrzehnts gab es neue Energie in der Skinheadbewegung auf der Insel. Kulturell bzw.
musikalisch wie auch von der Zahl der auf den Straßen gesichteten Kurzhaarigen. Hinsichtlich der musikalischen Entwicklung machte man einen gewaltigen Sprung. Zum einen gab es im SKA neue
Impulse.
Der typische Off Beat wurde mit punkigen Rhythmen unterlegt, Ska wurde schneller, erhielt eine neue Note. Bands wie die Specials, The Selecter, The Beat, Bodysnatchers
oder auch Bad Manners und Madness standen im Rampenlicht. Diese Ära wurde nach dem prägnantesten derzeitigen Plattenlabel "Two Tone" benannt. Das übrigens bedeutet so viel wie Zweifarbigkeit. Nicht
Rot und Grün, nein Schwarz und Weiß. Auf den Plattencovers, auf der Bühne und in der Musik. Und noch etwas entstand, das fortan zu einem Markenzeichen für Skinheads wurde wie DocMarten's Schuhe,
kurze Haare und Hosenträger: Oi!
Oi! Stand für Aggressivität, für Widerstand und Aufruhr gegen Establishment und Vereinnahmung von außen. Die Nähe zum Punk war unüberhörbar. Oi!-Bands hatten
gemeinsame Gigs mit Punkkapellen oder aber Skins spielten mit Punks zusammen in ihren Combos. Der entscheidende Unterschied war der, dass Punk sich im laufe der Zeit entweder immer mehr politisierte
oder im Gegenzug kommerzialisiert und ausgeschlachtet wurde. Oi! War die Alternative für die Kids, die den Linksrutsch des Punk oder seine marktfähige New Wave-Variante nicht mittragen wollten. Nur
stellvertretend seien hier die Cockney Rejects genannt, die das Wort Oi! Zum Markenzeichen machten. Nicht als stotterfreundliche Sie Heil-Variante, sondern als einen Straßenruf, der hierzulande auch
nicht mehr als "Eh" bedeuten würde. Kein blutrünstiger Schlachtruf, sondern Muttersprache. Kulthits wie "If The Kids Are United" von den Sham69 entstanden. Cock Sparrer, The Opressed, 4 Skins, The
Business bestimmten die Szene.
An diese Zeit jedoch schloss sich auch die Entwicklung an, die der Skinheadbewegung auf ewig ihr negatives Image verpasste. Nazigruppen wie das British Movement oder die
National Front begannen verstärkt, unter Skinheads ihre Propaganda zu machen, versuchten sie auf ihre politische Seite zu ziehen. Verbrämter Patriotismus, der zum Nationalismus manipuliert wurde und
die auch schon erwähnten Neigung vieler Skins, gern den Haudrauf zu spielen, ließ es relativ leicht geschehen, dass nicht wenige Kurzhaarige zu Saalschutzgorillas oder Rollkommandos von rechten
Parteien mutierten, denen man eigentlichen Gehalt der Skinheadszene so gut wie nichts lag.
Und natürlich war diese relative Minderheit für die sogenannte Öffentlichkeit weit interessanter, als der normale Rest, über den keine brutalen Übeltätergeschichten
geschrieben werden konnten. Zumal, und das bestätigt sich in den heutigen Tagen unübersehbar, wenn Einstellungen wie Rassismus auf äußerlich auszumachende Randgruppen begrenzt werden kann und die
breite Bürgermasse aufatmet, dass sie ja eigentlich nicht zu den Bösen gehört. Mit dieser Politisierung entfernten sich Teile der Skinheadbewegung in doppeltem Sinne von ihrem Ursprung. Zum einen der
Politisierung überhaupt wegen. Vordergründige politische Inhalte hatten das Selbstverständnis und den Zusammenhalt der Bewegung bisher nicht bestimmt. Selbst wenn die einzelnen Leute ihr Handeln
politisch verstanden hätten. Zum anderen wiedersprach Rassismus einfach dem Umstand, dass "Skinhead" in seinem Ursprung nicht die Angelegenheit irgendeiner Edelrasse, sondern Produkt der Vermischung
verschiedener kultureller Stile und Strömungen war.
Die Spaltung oder Neuformierung der Szene vollzog sich aber nicht nur aufgrund des wachsenden Einflusses politisch extremer Kräfte. Sie schlug sich auch in neuen
Lebensstilen, in Reibereien zwischen den Urgenerationen und den Nachwachsenden nieder. Die "alten", konservativen standen jetzt stellenweise gegen die "jungen", rebellischen. Smartheit gegen punkige
Widerborstigkeit auch im Outfit, Festhalten an alten Idealen contra Entwickeln neuer Strömungen. Zu den traditionellen Klamotten kamen neumodische. Skins trugen jetzt mit scharfen Reinigungsmitteln
entfärbte Jeans, Bomberjacken und andere Militärkleidung. Die Stiefel wurden höher und, was ganz wesentlich war, die Haare kürzer. Nassrasierte Vollglatzen, die das Böse-Buben-Image der Skins auch
heute noch bestimmen, tauchen erst zu dieser Zeit auf.
Mit dem Makel der bereitwilligen Dienstleistung für Rechtsaußen versehen, begann die Skinheadkultur jedoch, über die Gre3nzen des Inselreiches hinaus populär zu werden. Wieder nicht unwesentlich von den Medien forciert, denen einfache Buhmänner offensichtlich nicht nur bei den Briten lieb waren. Die tatsächliche Entwicklung der europäischen Skinheadszene verlief zwar nicht in der Form, dass lediglich radikale kurzhaarige Zombies durch die Lande liefen. Aber der Ruf der Innung war verbogen. Fortan existierten verschiedene Richtungen in der Skinheadbewegung. Politisierung trat auch auf der Gegenseite der bereits genannten auf. Redskins entwickeln sich, die teilweise das politisch entgegengesetzte Potenzial abschöpfen wollten. Die breite Masse bemühte sich weiterhin, nicht in den Strudel gezogen zu werden. Alle beanspruchten für sich, das Wahre zu vertreten. Oi!-Skins sammeln sich unter der Parole Spaß in der strikten Ablehnung all dessen, was nur den Hauch einer politischen Position hat. Die Toleranz verschiebt sich hier häufig und unregelmäßig nach rechts oder links. Jedenfalls werden die Wurzeln in der Rebellion gegen alles gesehen, was sich dem eigenen Selbstbewußtsein widersetzt hätte. 1988 wurde in den USA eine Initiative aus der Taufe gehoben, die dem rassistischen Trend in der Skinheadbewegung und auch dem Sudelimage bewusst entgegentreten wollte. S.H.A.R.P. heißt ausgesprochen Skinheads Against Recial Prejudice und übersetzt "Skinheads gegen rassistische Vorurteile". Gesagt werden sollte nichts anderes, als dass sich bewusst auf die gemischten Wurzeln der Bewegung bezogen und der rassistischen Beeinflussung entzogen werden sollte. Allerdings wirkte politische Beeinflussung auch hier so hart, dass entgegen der eigentlichen Absicht S.H.A.R.P. in der Öffentlichkeit oft näher an eindeutig linken Kreisen oder der autonomen Antifa orientiert schien als an der Skinheadbewegung.
Die Skinheadszenen, die sich in den Ländern des ehemaligen Ostblocks entwickelt haben, nahmen, denke ich, einen besonderen Weg. Nicht dass sie besonders kurze Haare
gehabt hätten oder besonders schlecht oder gut gewesen sind. Aber dort waren jegliche Subkulturen Zielobjekt staatlicher Repression. Nicht als ungezogene Rüpel, die nicht in das Bild der jeweils zu
entwickelnden Persönlichkeiten passten. Mehr als Feinde einer Ideologie, eines gesellschaftlichen Dogmas. Das ändert wenig an möglicherweise gemeinsamen Idealen oder Geschmäckern, wohl aber am
Selbstverständnis und am Zusammenhalt. Skinheads sind schon lange keine homogene Masse mehr, die man bequem über einen Kamm scheren könnte. Sie sind untereinander so verschieden wie der ganze Rest
der sogenannten normalen Leute. Vielleicht verstehen sie nur, besser zu feiern.
Sascha Quäck